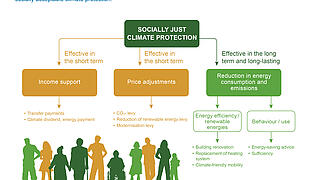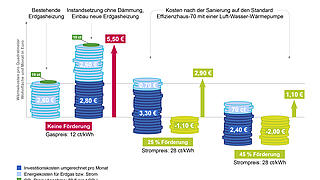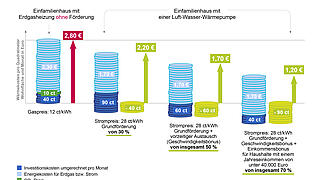Die Energiewende ist in vollem Gange: Die Bundesregierung hat mit dem verschärften Klimaschutzgesetz das Ziel für Deutschland verankert, bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral zu werden. Die Klimaschutzziele bis zum Jahr 2030 schreiben eine Minderung der klimaschädlichen Treibhausgase um 65 Prozent gegenüber 1990 fest. Wesentliche Stellschrauben für mehr und schnelleren Klimaschutz sind der Ausbau der erneuerbaren Energien und mehr Energieeffizienz.
Doch auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität steht Deutschland vor Herausforderungen –
- beim Kohleausstieg,
- beim Gasausstieg oder
- bei CO2-Minderungen im Wärme- und Mobilitätsbereich.
Hier werden die gesteckten Ziele bis zum Jahr 2030 ohne weitere ambitionierte Maßnahmen voraussichtlich nicht erreicht. Welche Ursachen die Klimaschutzlücke hat und wie sie geschlossen werden kann, zeigt das Öko-Institut in zahlreichen Arbeiten.
Dabei liegt der Fokus sowohl auf der effektiven Ausgestaltung von politischen Instrumenten wie der Verbesserung des EU-Emissionshandels oder der ambitionierten Ausgestaltung eines CO2-Preises als auch auf der Entwicklung von Szenarien für den Einsatz von klimaneutralem Wasserstoff. Nicht zuletzt unterstützt das Öko-Institut Regierungen dabei, bei den internationalen Klimakonferenzen verschiedene Aspekte der Verhandlungen zu analysieren und darzustellen.
Auf der Webseite www.energiewende.de des Öko-Instituts sind aktuelle Forschungsergebnisse unserer Arbeit zu Themen der Energiewende zusammengestellt. Der umfassende Überblick reicht von Klimaschutz in Deutschland, der EU und weltweit bis hin zum Umstieg auf erneuerbare Energien wie Photovoltaik, Windkraft und Wasserkraft. Dabei untersuchen wir die Auswirkungen der Energiewende auf die Energieinfrastruktur, nachhaltige Mobilität, Privathaushalte sowie Wald- und Landwirtschaft. In unseren Analysen werden ebenso notwendige politische, technologische und gesellschaftliche Maßnahmen für eine erfolgreiche Umsetzung thematisiert.